Seit gestern also befinde ich mich in meiner wohlverdienten Blogpause. Ich genieße es geradezu, nicht mehr schreiben zu müssen. Aber ist es denn wirklich ein Muss? Ein Zwang?
Mitunter ja, mitunter nein.
Es gibt Texte, die unter dem Druck entstehen, irgendetwas schreiben zu müssen, da es mir wehtut, in einer Woche beispielsweise nur zwei Texte hier zu veröffentlichen. Eine sinkende Schlagzahl ist übrigens oft der Anfang vom Ende. Und natürlich werde ich nicht ewig das seppolog weiterführen. Meist kommen diese zwanghaften Texte nicht gut an, wobei Ausnahmen völlig überraschend gut einschlagen, sodass ich dann denke: „Ich kann es noch!“ Ich bin also durchaus selbstkritisch, teilweise über Gebühr.
„Die Homestory (II)“ beispielsweise kam anders als ihr erster Teil nicht gut an. Das war mir schon beim Verfassen klar, da ich den Text nicht am Stück, sondern über zwei Tage verteilt abschnittweise schrieb, was nie gut funktioniert. Ich merkte, dass ich krampfhaft schrieb und nicht einmal meine eigene Rolle in der Geschichte stringent durchgezogen habe. Eigentlich wollte ich mich überheblicher und abgehobener darstellen, als es letztlich der Fall wurde. Versehentlich geriet ich an einigen Stellen sogar sympathisch, was nie dafür geeignet ist, eine Geschichte voranzutreiben. In meiner Verzweifelung baute ich sogar meine Mitbewohnerin ein, die grundsätzlich – übrigens auch im wahren Leben – Symptahieträgerin ist; neben ihr stehe ich immer schlechter da, das macht die schwarzweiße Rollenverteilung einfacher.
Außerdem kommt es gerade bei Frauen gut an, wenn der männliche Teil einer Liebesbeziehung als Trottel dargestellt wird. Ich frage mich seit Jahren, was diesen Trend begründet, Männer zu Tölpeln zu machen. Es spricht mehr gegen die Frauen als gegen die Männer. Es sagt viel darüber aus, wie viele – nicht alle! – Frauen sich sehen. Immer wieder fällt mir im realen Leben auf, wie Frauen untereinander über ihre Lebenspartner sprechen. Aus einem unerfindlichen Grund machen sie ihn gerne lächerlich. Diese Beobachtung haben mir Freundinnen bestätigt. Hingegen kenne ich keinen Mann, der sich über seine Freundin lustigmacht.
Insbesondere am Ende des Textes der Homestory wird meine Verzweifelung deutlich: Ich lasse die Handelnden einfach einschlafen, um zum Ende zu finden. Ehrlicherweise muss ich aber einwenden, dass Schlaf immer Komik inne ist und vermutlich werde ich mich irgendwann an einen dritten Teil machen, in dem ich mir wieder meine gewohnte Arroganz andichten kann, was die Fallhöhe meiner Person vergrößert, wodurch ja eben die Komik erst entsteht. Dass das dann nicht stringent ist, dass meine Rolle sich innerhalb von drei Texten verändert, ist mir dann auch egal, Hauptsache, der Leser schmunzelt. Mit der Logik nehme ich es nicht so ernst – der Witz muss im Vordergrund stehen.
Manch Text kommt auch deshalb nicht gut an, weil er zu abstrus gerät. Ich selbst mag jedoch genau das, ahne aber, dass ich dem Gros der Leser dadurch jeden Grund nehme, am Ende auf „Gefällt mir“ zu klicken, da ich ihm vermutlich Zeit gestohlen habe.
Innerhalb der ersten 30 Minuten nach Veröffentlichung weiß ich, ob ein Text Anklang findet oder nicht. Tut er es nicht, analysiere ich:
Ungünstige Tageszeit zum Veröffentlichen? Zu gutes Sommerwetter? Abschreckende, langweilige Überschrift? Mieser Text? Selten finde ich Antworten auf diese Fragen, sodass ich mich im Zweifel an den nächsten Artikel setze, der dann einfach besser sein muss, um den vorigen vergessen zu machen. Gestern Abend, als ich im Zug zwei Alltagsgeschichten verfasste, die sogar wahre Begebenheiten wiedergaben, ist mir das gelungen: das Tilgen der Schmach der schlechten „Homestory (II)“. Und das sind dann die Momente, die mir wieder vor Augen führen, warum ich so gerne schreibe. Schreiben muss zügig ablaufen. Die besten Texte sind stets die, die ich am Stück innerhalb von 20 bis 30 Minuten runterschreibe ohne abzusetzen. Sobald ich aber absetzen muss, um zu überlegen, was zur Hölle ich eigentlich mitteilen will, weiß ich, das wird der Leser merken. Und dieses Wissen verursacht unmittelbare Schmerzen.
Grundsätzlich schreibe ich für andere – und dann erst für mich. Ich habe Schwierigkeiten, Menschen abzunehmen, sie schrieben nur für sich selbst, es dann aber dennoch veröffentlichen. Allerdings folge ich an zweiter Stelle, denn es gibt Tage, an denen ich den euphorischen Drang verspüre, sofort etwas niederzuschreiben. Der Rausch liegt im Gelingen kurioser Wortphrasen, humoriger grammatikalischer Konstruktionen, die aus dem Nichts heraus kommen, die ich nie planen kann. Oftmals weiß ich zu Beginn des Schreibens: Heute sprudeln die Worte geradezu aus mir heraus; da muss ich nicht nachdenken, da tippe ich einfach drauf los. Ich bin also nicht nur negativ selbstkritisch, sondern auch durchaus positiv. Das kann in einigen Fällen in einer Euphorie münden, durch die ich dem Urteil der Leser gleichgültig gegenüberstehe. Es gibt Texte, die dramatisch schlecht ankamen, die ich selbst aber so genial finde, dass ich regelrecht stolz auf sie bin. Auch der umgekehrte Fall ist möglich. Was ich für großen Dreck halte, kann – oft kommt das nicht vor! – beim Leser einschlagen.
Meine schärfste Kritikerin ist meine Mitbewohnerin, die diese Texte hier mit einigen Tagen Verzögerung liest. Da sitzt sie abends im Bett neben mir und sagt plötzlich:
„Diesen Text finde ich aber irgendwie langweilig. Zu schreibst ja nur über dich!“
„Ich schreibe immer über mich!“
„Ja, aber hier ist das irgendwie so belanglos. So langatmig. Hier nimmt man dir die Arroganz ja tatsächlich ab!“
Ihre Kritik stürzt mich dann in eine fünfminütige Sinnkrise. Nehme mir dann vor, sofort was Sensationelles zu schreiben. Aber so läuft es ja eben nicht. Man kann es sich nicht vornehmen. Das wiederum ist ein großes Plus des Schreibens, denn es macht die ganze Nummer bequem: Man muss sich nicht anstrengen, da ich realisiert habe, dass gute Texte von alleine entstehen. Sobald ich mir vornehme, etwas Gutes zu schreiben, wird es schlecht. Die Stimmung muss einfach stimmen. Aus Melancholie entstehen Meisterwerke, aus Aufgedrehtheit ebenso. Stimmungen dazwischen liefern: nichts.
Das Schreiben auf meinen langen Zugfahrten ist eine zweischneidige Angelegenheit. Gerade bei den Fahrten montagmorgens bin ich von Müdigkeit übermannt und empfinde selbst das Herausholen meines Laptops aus meiner Tasche als eine unüberwindbare Aufgabe. Auf den Rückfahrten wiederum, die abends stattfinden, stimmt oftmals die Atmosphäre nicht, die es zum guten Schreiben braucht. Das kann schon der falsche Sitznachbar sein, der einem permanent auf den Laptop starrt – ich hasse es, wenn ich beim Schreiben nicht einigermaßen alleine bin. Überhaupt: Kreativität kann ich alleine am besten. Will ich mir ein neues Sendeformat ausdenken (www.seppo.tv), brauche ich dafür eine halbe Stunde. Derzeit gehe ich mit einer Idee schwanger, die das Fernsehen natürlich nicht revolutioniert, aber einen für mich neuen Ansatz bietet. Ich sollte es einfach mal machen – und exakt so denke ich immer: einfach mal machen, nichts kaputt denken. Auch bei diesem Text. Eigentlich wollte ich Wäsche waschen. Auf dem Weg zur Waschmaschine traf ich den Laptop, setzte mich hin, um einige Korrekturen an den gestrigen Texten vorzunehmen, kam ins Überlegen, dann ins innerliche Schwadronieren und schrieb einfach.
Geschieht auch oft: Habe eine Idee zu einem ungünstigen Zeitpunkt, gerne nachts, wenn ich mal wach werde. Dann liege ich da und beginne, im Kopf zu formulieren. Plötzlich kommen da niederschriftfähige Sätze bei raus, die ich aber nicht sofort niederschreiben kann, da ich ja eigentlich schlafen will. Auch die beiden Artikel, die gestern im Zug entstanden (Die Atmosphäre stimmte!), formulierte ich schon am Bahnsteig, saß da ungeduldig in der Sorge, die Sätze wieder zu vergessen, bis der Zug eingetroffen ist. Der Vorfall mit der Hosenkette ereignete sich eben nicht gestern, sondern schon vor vielen Wochen. Warum schrieb ich ihn nicht schon früher nieder?!
Dagegen steht und bleibt aber das krampfhafte Schreiben, das zu miesem Auswurf führt. Gerade deshalb habe ich gestern beschlossen, eine Pause einzulegen, wie ich es ja durchaus schon einmal tat. Und gerade genieße ich es, nicht schreiben zu wollen und nicht zu müssen. Heute einfach mal an andere Dinge zu denken. Denn heute steht eine Stichsäge im Vordergrund.

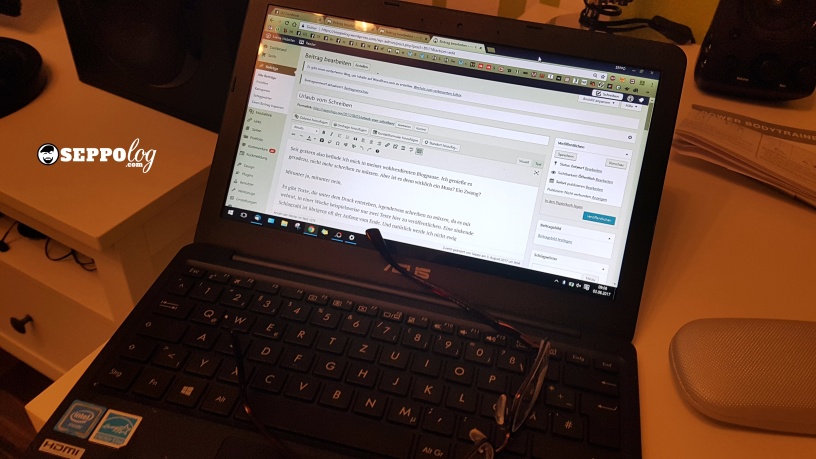



Die Stichsäge ist der korrekte Gegenpol zum Schreiben. Lass es krachen.!
LikeGefällt 1 Person
„Ihre Kritik stürzt mich dann in eine fünfminütige Sinnkrise.“ = bester satz ever.
LikeGefällt 1 Person
Ganz schön langer Text über das „Nicht-Schreiben-Müssen“…
LikeGefällt 4 Personen
„Aus Melancholie entstehen Meisterwerke, aus Aufgedrehtheit ebenso. Stimmungen dazwischen liefern: nichts.“
Genau so ist es. Das ist das Einzige, das meine berufliche und private Schreiberei gemeinsam haben. Schreiben ist manchmal eine komplizierte Sache. Und wenn es kompliziert ist, ist es Mist.
LikeGefällt 3 Personen
Das mit den Sinnkrisen kenne ich, bei mir halten sie allerdings etwas länger als 5 Minuten an. Manchmal brauche ich mindestens 6 Stunden Schlaf, um sie zu überwinden! :)
LikeGefällt 1 Person
seppo my hero :)
schreibt sogar wenn er nicht schreiben muss ;P
wünsch dir einen schönen urlaub :D
LikeGefällt 1 Person
Ich mag deine Art zu schreiben! Ich habe erst gerade mit meinem Blog gestartet, und worüber zu schreibst, das merke ich auch! Ich fotografiere schon länger, aber viele meiner “ Werke“ habe ich garnicht gezeigt. Man ist so selbstkritisch und manchmal reicht ein negatives Wort schon aus mich total zu verunsichern. Daher habe ich so lange gezögert weiter zumachen. Einen Blog zu eröffnen, war ein riesen schritt! Die Stimmung muss passen, das ist richtig. Nicht soviel nachdenken, nicht 10x den Text umschreiben, denn dann wirkt er nicht mehr.
Ich bin gespannt wie das bei mir weiter geht und auch wie bei dir!
LikeGefällt 4 Personen
Ist ja interessant wie lange deine Schreibpause gedauert hat. :)
LikeGefällt 6 Personen
ganz schön viel erklärung zum thema blogpause …..;-) ….. um genau zu verstehen was du uns sagen willst muß ich den ganzen blog nochmal in aller ruhe lesen ,du darfst nicht vergessen ich bin schon etwas älter und damit begriffstutziger …. was mir persönlich gefällt ist dass du über ein nichts -sagendes thema noch ganze romane verfassen kannst und am ende alles so professionell aussieht ….hätte ich einen hut so würde ich ihn lüften …. schönen tag und ein paar stressfreie tage wünscht die wolfskatze
LikeGefällt 4 Personen
Ja, das Blogger-Leben hat es wohl in sich! Mir als Frischling tut es jedoch sehr gut zu lesen, dass auch alte Blog-Hasen (ist das jetzt politisch unkorrekt?) bisweilen eine Bloggade haben.
Wenn jemand dieses Druckgefühl gut verstehen kann, dann bin ich es. Ich hatte in einem Anfall von Naivität, gepaart mit Größenwahn die Aussage getätigt, dass ich JEDEN Tag bloggen werde und das für die nächsten 365 Tage. Ganz schön bescheuert, oder?! Der eigentliche Wahnsinn besteht aber darin, dass ich immer noch versuche dies in die Tat umzusetzen! Dabei legt man die Messlatte dann auch noch so hoch, dass man eine Leiter mitbringen muss um drüber zu klettern.
Und dann gibt es ja noch diese Leser!!! Ein seltsames Völkchen – unberechenbar, grausam, großartig. Ach, jetzt habe ich schon wieder so viel geschrieben – Diagnose: unheilbar, würde ich sagen. Also Vorsicht, auch Stichsägen können zu Inspiration führen – da weiß ich gar nicht was ich dir für deine Pause wünschen soll…vielleicht einen klaren Kopf und eine ruhige Hand?!
LikeGefällt 5 Personen
Blogpause als Motivation zum Schreiben – sehr schön. Denn macht nicht alles gleich viel mehr Spaß, wenn man es nicht tun muss? Warum also sollte man es ausgerechnet dann lassen? Wünsche eine angenehme und produktive Blogpause.
LikeGefällt 4 Personen
Ganz ehrlich – Ich musste wirklich grinsen bei deiner Homestory Teil 2 und nach den Kommentaren war das ebenfalls nicht so schlimm. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass du als Autor nicht zufrieden bist.
Jedoch ist es tatsächlich nicht gut, dass du dich zum Schreiben gezwungen fühlst, denn es ist doch eigentlich etwas was frei machen soll. Also genieß die Pause und komm mit einem freien Kopf zurück! ;)
LikeGefällt 1 Person
Beeindruckend wie du mehr schreibst, wenn du nicht schreibst, als andere, die schreiben ;-)
LikeGefällt 3 Personen
ER antwortet nicht mehr. Seppo I antwortet nicht mehr. Seppo I, hier Roger, over, bitte antworten. Captain Over, übernehmen sie. Roger, Ltnd. Roger, over!
LikeGefällt 2 Personen
Ohne meine VorSchreiber wiederholen zu wollen, kann ich mich nur anschließen und sagen, dass ich es liebe Deine Texte zu lesen…Dass Du aus dem Thema Blogpause einen solch langen und wieder richtig guten Beitrag machst, spricht auch schon wieder für Dich/sich…
LikeGefällt 1 Person
Aha, du schreibst also nicht, das is ja, als wenn ich sage ich sag jetzt nix mehr und mein Redefluss mich an der Umsetzung hindert 😂🤣
LikeGefällt 1 Person
Du schaffst es mit einigen deiner Texte meine Stimmung vorwegzunehmen, so als würde ich gerade meine eigenen Gedanken schwarz auf weiß lesen. Das ist schon faszinierend^^
Danke für diesen schönen Artikel! ;-)
LikeGefällt 1 Person
Pass mit der Stichsäge auf, sonst dauert das Tippen von Artikeln demnächst eine Stunde und nicht mehr „nur“ eine halbe. Diese Verzögerung wirkt sich darüber hinaus auf die Qualität der Texte auf, gehemmtes Schreiben, weil die (dann noch vorhandenen) Finger dem Hirn nicht mehr folgen können, nervt den Schreiberling zu sehr.
Fröhliche Blogpause :).
LikeGefällt 1 Person
Des Bloggers Pause ist offenbar kein Blogger´s Block…
Noch ein paar Milliarden Jahre, dann dehnt sich die Sonne über die Erdumlaufbahn hinweg aus, dann war alles für die Katz´; ich vermute, dass es sich um die von Schrödinger handelt. Woher also noch eine Sinnkrise nehmen?
Seppo schreibt ausschließlich hervorragende Texte: für alles andere würde er niemals auch nur einen Finger auf die Taste senken!
LikeGefällt 1 Person
Zur Fakten und statistiksammlungszwecken: Texte, die hier in der Blogpause aufploppen, kommen sehr gut bei mir an!
LikeGefällt 1 Person
… aus eigener Erfahrung: manchmal, meistens, ist es besser einen Text wieder beiseit zu legen und erst nach dem dritten Mal zu veröffentlichen. Man findet immer etwas, was noch verbesserungswürdig ist und das hört auch nicht auf. Mal ist es ein ganzer Satz, der löschenswert ist, manchmal nur ein Buchstabe oder es fehlt mal wider einer und ärgert sich darüber, weil esvöllig unnütze nacharbeiten gibt. In der Zeit hätte mann sonst was … . und so weiter …
Aber aufhören? … Nö! Abgelehnt.
Etwas angsamer, bedachter vielleicht. Ich schaffe auch nicht alles an einem Tag … wie die Sache damals mit Rom. Da war das genauso.
Pause ist okay und notwendig. … genießen wir diese kleinen Pausen und simulieren derweil darüber, was man sonst noch so alles machen könnte … außer schreiben – und dabei körperlich nur die Finger und Gehirnwindungen zu betätigen.
LikeGefällt 1 Person
Ich wette, dass jetzt wo du genau weißt, dass du in nächster Zeit nichts veröffentlichen wirst, die besten Ideen entstehen werden. So kannst du quasi vorschreiben und wenn die Pause oder der Urlaub aus ist, haben wir wieder richtig viel zum lesen! *freu*
LikeGefällt 2 Personen
Ich habe mich jetzt ein bisschen durch deinen Blog gelesen und finde deine Artikel ziemlich interessant und auch unterhaltsam. Der Blog ist auch optisch gut gestaltet. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg und Spaß beim schreiben.
Mit besten Grüßen,
Wolfgang Dibiasi
LikeGefällt 1 Person
Ok, ich geh jetzt auch in Blog Pause – vielleicht bekomme ich dann auch so eine tolle Kritik 😎
LikeGefällt 1 Person