In diesem Text wird es um das Wetter gehen. Er schlägt ungalant den Bogen zu meiner sportlichen Betätigung und lässt mich selbst beim Schreiben nachdenklich werden. Heute ist für mich ein Tag zum Zurückblicken. Doch beginnen wir mit einigen Überlegungen zu den Wetterverhältnissen.
Einst war der Frühling die mir liebste Jahreszeit, doch habe ich den Eindruck, es ist in der Tat der Klimawandel, der mir diese Vorliebe in den vergangenen Jahren verhagelt hat. Allerdings, so entnehme ich lesend des Aussagen von Experten, Leuten also, die wissen können, wovon sie reden, kann man noch gar nicht sicher sagen, ob die derzeitigen Wetterextreme, die ja nur für unsere Verhältnisse extrem sind, wirklich schon Vorboten des Klimawandels sind; dazu ist der Beobachtungscaitraum einfach noch zu kurz. Um jedoch Zeit zu sparen, lege ich mich fest und schiebe den verkorksten Frühling sowie den kuriosen Sommer auf den Klimawandel, der freilich vom Menschen mindestens beschleunigt worden ist. Doch klagen wir hierzulande nicht auf zu hohem Niveau, denn es geht uns hier nicht an Kopf und Kragen. Das Wetter ist lediglich etwas unleidlich. Die durch den Klimawandel zu erwartende Not erschüttert andere Regionen dieser ungerechten Welt viel existenzieller.
Einen Frühling, wie ich ihn schätze, gab es in diesem Jahr nicht und, wie ich meine, auch 2016 nicht. Der Übergang vom nur noch milden Winter, der sich inzwischen eher als eine Art Herbst geriert, in einen im Grunde permanent schwülen Sommer ging übergangslos vonstatten, was ich daran festmache, dass ich zwar mehrere Übergangsjacken habe, nie aber zum Tragen dieser komme. Künftig werde ich sie im Winter anziehen können, wenn die Temperaturen auf zwölf Grad fallen.
Die „Bild“-Zeitung ist eine verlässliche Meteorologie-Instanz. Jedes Jahr warnt sie aufs Neue vor der Sahara-Hitze im Sommer und der Schneewalze im Winter. Zwischen diesen Extremen berichtet sie über neue Erkenntnisse in Bezug auf Reichskanzler Adolf Hitler oder das Liebesleben von Ingo Nommsen, dem (neben mir) am meisten unterschätzten Showstar. Kleiner Scherz.
Heute, an meinem freien (Ausgleichs-)Tag, stelle ich fest, dass ich künftig voll auf den Spätsommer oder meinetwegen Frühherbst setzen werde. Ich behaupte, ab sofort wird klimawandelbedingt im Herbst das Wetter stattfinden, das uns früher das Frühjahr geschenkt hatte. Untermauert wird diese These von eben der „Bild“, die jetzt schon weiß, dass wir einen goldenen Herbst bekommen werden. Zwar weiß ich aus sicherer Quelle, dass Meteorologen – wenn es hochkommt – nur drei Tage in die Zukunft blicken können, alles darüber hinaus absolute Spekulation ist, unseriöse obendrein: Niemand weiß auch nur ansatzweise, wie in der kommenden Woche das Wetter wird. Dennoch wird dieser Vorhersagen-Markt bedient, einfach weil die Nachfrage da ist. Und trotzdem erwarte ich nun einen sensationellen Herbst und der heutige Tag ist für mich beispielhaft.
Den Sommer, den ich heute für beendet erkläre, habe ich überwiegend im eigenen Saft verbracht. Abends nach der Arbeit, die nur in übersichtlichen Teilen von einer Klimaanlage begleitet wurde, war das Ausziehen meiner Schuhe ein Fall für die Vereinten Nationen, die den Einsatz von Giftgas in kriegerischen Konflikten ächten. Hätte ich mir in Syrien die Schuhe ausgezogen, ein Obama hätte nach diesem Überschreiten der roten Linie in den Krieg ziehen müssen.
Der Sommer ist nur noch ein schwüles Irgendwas und ich erwische mich bei einem „Früher war das besser!“ Entweder die Sommer waren wirklich besser oder aber ich habe ein Alter erreicht, bei dem man grundsätzlich verklärend in die Vergangenheit blickt. Das aber wäre ein Totschlagargument und daher nicht zulässig. Außerdem bin ich, was das Große angeht, Optimist. Für mein eigenes Leben stelle ich immer wieder fest, dass der Status quo besser als der Status ante ist. Oder, um es pathetischer auszudrücken, nie war ich zufriedener, gar glücklicher!, als jetzt. Es ging mir nie besser.
Ich schlage nun jenen angekündigten Bogen zu einem weiteren Thema.
Wetter ist mir im Grunde egal. Doch für mich spielt es in einem Bereich eine sehr große Rolle: beim Laufen. Ich laufe fünf Mal die Woche und habe früh gelernt, dass man bei jedem, aber auch wirklich jedem Wetter laufen kann. Ob es nun minus zwölf Grad oder plus 40 Grad sind: Laufen geht immer. Wer etwas anderes erzählt, weiß nicht, wovon er spricht, denn entsprechende Belehrungen höre ich immer nur von eher sportlich inaktiven Menschen …
Was mir in diesem Sommer gefehlt hat, sind die Hitzeläufe bei eben solchen annähernd 40 Grad, die ich mir immer durch das Laufen durch öffentliche Rasensprenger (beispielsweise im hiesigen Volksgarten) erträglich machte. In diesem Jahr, so mein absolut objektiver Eindruck, brauchte es die nicht, da es meist eh geregnet hat. Eine Enttäuschung, zumal nach dem übersprungenen Frühling. Ein Lauf durch absolute Hitze hat für mich Orgasmus-Qualität. Und ich halte meine Orgasmen für ziemlich hochklassig. Für fast so gut wie die, die ich auszulösen vermag.
Heute war ein Frühlingstag. Ist noch. Ich beschloss, in meiner alten Wohngegend laufen zu gehen, mich also mit meinem Toyota nach Düsseldorf-Grafenberg zu bewegen, um eine alte Laufstrecke zu laufen, die ich zuletzt im Dezember 2011 beschritten hatte. Die für mich interessante Frage war, wie lange ich heute für die Runde brauchen würde, nachdem ich damals im Schnitt 52 Minuten auf ihr unterwegs war – noch als Fersenläufer, der ich seit 2013 zugunsten des Vorfußlaufes nicht mehr bin. Um es vorwegzunehmen: Wie erwartet und -hofft war ich etwa sieben Minuten schneller unterwegs, was schlicht dem Vorfußstil geschuldet ist. Und vielleicht auch dem heute sensationellen Wetter, das mich an das erinnert hat, was mir seit einigen Jahren fehlt: an Frühling.
Ich startete vor dem Haus meiner alten Mietwohnung. Inzwischen hat mein damaliger Vermieter, mit dem ich noch Jahre nach dem Auszug 2012 eine Art Kontakt hatte, die Fenster ausgewechselt. Nostalgisch, ja fast melancholisch!, blickte ich in meine alte Wohnung, die nicht mehr als ein 30-Quadratmeter-Zimmer war.
Eigentlich verbinde ich mit der damaligen Zeit wenig Gutes. Ich haderte einstens mit Düsseldorf, einer Stadt, die noch eingebildeter ist als ich, in der ich zu allem Überfluss auch noch eine Wochenendbeziehung mit meiner Mitbewohnerin führte, die damals noch gar nicht meine Mitbewohnerin war, aber bereits meine Mitbewohnerin, was Neuleser nun irritieren dürfte. Zu jener Cait sahen wir uns nur am Wochenende. Und hätte ich 2008, dem Jahr meines Umzuges von Münster nach Düsseldorf, gewusst, dass das vier Jahre so gehen würde, ich hätte Münster nie verlassen. Diese Frau muss man einfach länger als zwei Tage pro Woche erleben dürfen.
Und trotzdem war da heute diese Nostalgie. Da war mein alter Stamm-Kiosk, mein alter Stamm-Imbiss, mein alter Stamm-Geldautomat sowie mein alter Stamm-„Rewe City“, in dem ich eben noch einkaufen war. Zwar ist er inzwischen renoviert, doch traf ich meine alte Stamm-Kassiererin wieder, die anders als ich um fünf Jahre gealtert ist. Freilich hat sie mich nicht wiedererkannt …
Die alte Stamm-Strecke, die ich lief, habe ich damals gehasst. Wie jede Strecke in Düsseldorf-Grafenberg, da sich dieses Viertel vom nahen Wald abgesehen zum Laufen nicht eignet. Laufen kann, das gebe selbst ich zu, sehr schnell langweilig werden; es hängt vieles von der Beschaffenheit der Laufstrecke ab. Lange Geradeausabschnitte sind der Tod jedes Laufspaßes und in Grafenberg muss man immer erst lange Wege geradeaus laufen, um irgendwohin zu kommen. Zum Mörsenbroicher Ei beispielsweise, wie die große Kreuzung sich nennt, in die auch die A52 mündet, und die auch oftmals versehentlich „Mösenbroicher Ei“ genannt wird. Doch ab da wird die Strecke interessant, ich kreuzte die Autobahn, lief verbotenerweise über das „Mercedes“-Werksgelände, um an die Düssel zu gelangen, die dort aber Kittelbach heißt – als Arm der der Stadt namensgebenden Düssel. Der Kittelbach fließt entlang den Gleisen, die zum Hauptbahnhof führen, beziehungsweise von diesem weg in Richtung, sagen wir mal, Berlin-Spandau. So gesehen bin ich jede Woche zweimal dort, wenn ich pendle.
Da ich zur Melancholie neige, insbesondere dann, wenn sie mit Nostalgie einhergeht, überkam es mich dort: Ich blieb stehen, schaltete meinen „iPod“ ab, der gerade wie sooft „Wizo“ abspielte, und betrachtete die Düssel. Und dachte:
„Hier also bist du“ – ich meinte mich damit – „vor sieben Jahren sooft hergelaufen!“
Solche Dinge können mich umhauen. Und dann wurde reflektiert. Was ist in diesen Jahren nicht alles passiert? Damals trat ich nach dem Studium meinen ersten Job an, den ich so lange ausfüllte, bis mein damaliger Arbeitgeber sehenden Auges in die Insolvenz schlitterte, was an sich niemanden überrascht hatte, da Soziopathen nicht immer die besten Entscheidungen treffen (was hier als ganz allgemeine Aussage aufgenommen werden darf); damals erlebte ich etwas, das man im Arbeitsrecht Kurzarbeit nennt, was aber bezahlter Freizeit gleichkommt, und damals erlebte ich, wie sich massiver Stress durch Arbeit auf die Ohren auswirken kann. Damals wurde ich ein bisschen erwachsener.
Ein paar wenige Jahre älter bin ich geworden, stellte ich fest, aber auch körperlich fitter, worauf ich mir für meine eigene Person gnadenlos einen einbilde, da ich behaupte, als Zwanzigjähriger bereits den körperlichen Zustand eines Vierzigjährigen erreicht zu haben. Das hatte ich irgendwann umgekehrt und dafür spricht auch die Tatsache, dass ich diese Strecke heute so deutlich schneller bewältige als damals. Das ist ein Grund dafür, dass ich dem Sport in meinem Leben absolute Priorität einräume. Es geht um so vieles mehr als nur um Muskelzuwachs. Es geht um eine Einstellung dem Leben gegenüber, um Ansprüche, die ich an mich selbst stelle. Hätte man der zwanzigjährigen Version von mir damals erzählt, wie ich mit 37 drauf sein würde, ich hätte schallend gelacht.
Den Lauf beendet genoss ich das Ausschwitzen in der heutigen Sonne. Die Luft so angenehm, wie sie in diesem Sommer selten war, nämlich einfach mal nicht schwül, dazu ein leichter Wind – ideal für das Laufen.
Und wie könnte ich den Tag angenehmer fortsetzen als mit der dritten Staffel von „Narcos“, die hoffentlich auch ohne den Sympathieträger Pablo Escobar funktioniert, und dem Kochen eines kohlenhydratarmen Gerichtes? Richtig, auf caine andere Weise. Meine Mitbewohnerin wird sich freuen, dass es wieder einmal ein Hackfleischgericht geben wird!
Und was mich an mir selbst zweifeln lässt: Warum erkenne ich erst in Staffel vier von „Bates Motel“, dass Normans Mutter Norma heißt?!



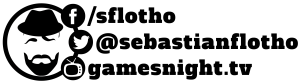

Du meteorakelst, dass im Herbst das Wetter stattfinden wird, das uns früher das Frühjahr geschenkt hat und schenkst uns somit gewissermaßen einen zweiten Frühling? Hach, ich möchte weinen vor (Vor)freude. Ich bin doch so ein Frühlingsmensch. ;)
LikeGefällt 1 Person
Die Jahreszeiten sind keine objektive Realität, sie sind Konstrukte des betrachtenden Subjekts und daher verflachen sie, wie alles andere auf der Welt auch…
Seppo läuft, Ratio fährt Rad: dazu ist jedes Wetter geeignet, schließlich ist Sport umgebungsinvariant!
Wer zum Teufel ist Ingo Mommsen???
LikeLike
Diesen Sommer hat mit Sicherheit jeder Nicht-Wassersportler im eigenen Saft verbracht – und wenn der Saft erstmal köchelt, ist das eigene bald Fleisch irgendwo zwischen „medium“ und „well done“. So fühle ich mich immer auf meinem Pferd nach dem Reittraining. Meine komplette Kleidung ist dampfgegart und das Gehirn durchgebruzzelt.
Kann das Spätfolgen geben? Zähes Muskelfleisch und ein Schmor-Hirn? Und wenn man spricht, kommt nur noch heiße Luft?
LikeGefällt 1 Person
Oh je, mein Hirn ist bereits verschmort… In der 2. und 3. Zeile muss es natürlich heißen: … ist das eigene Fleisch bald irgendwo zwischen „medium“ und „well done“.
LikeGefällt 1 Person
Ein Jeder, der sich Jogger nennt,
von A nach B im Sommer rennt.
Läuft dabei täglich auch viel Schweiß,
war’s dem Sportler wom zu heiß.
LikeLike
Die Hitz’… zu früh gedrückt…
Ein Jeder, der sich Jogger nennt,
von A nach B im Sommer rennt.
Läuft dabei täglich auch viel Schweiß,
war’s dem Sportler womöglich etwas zu heiß.
LikeLike