Nach Beendigung meines Urlaubes, der Post-Sommerfrische im Alpenvorland, die alles andere als zu dem geriet, das zwanghafte Nicht-Spießer gerne als spießig bezeichnen, wodurch sie selbst zum Spießer werden, ist meiner Mitbewohnerin und mir glasklar, was wohl das Highlight unseres „Aktiv-Urlaubes“ bleiben wird:
die 35-Kilometer-Wanderung um den Forggensee, dem mit rund 15 Quadratkilometern größten Stausee Deutschlands, nur knapp vor dem Münsteraner Aasee.
„Wie kann der Umfang des Sees denn 35 Kilometer betragen?!“, frage ich unsere Wander-App, mittels der wir die eine oder andere unserer Wanderungen planten, „Auf der Karte sieht der See so groß gar nicht aus!“
Dass die Dinge auf Karten kleiner aussehen als in der Realität, die sie immerhin maßstabsgetreu abbilden, sollte ich noch bitter lernen müssen …
„Man muss doch irgendwie von der Fläche auf den Umfang schließen können. Da muss es doch eine Formel geben. Irgendwas mit U gleich Pi mal Radius zum Quadrat oder so.“
Gibt es. Hab ich nur nicht gefunden, dafür eine App, die das für mich errechnet:
„Die 35 Kilometer aus der Wander-App stimmen nicht. Der See hat laut dieser Formel einen Umfang von, warte … von 13.729 Kilometern.“
Schweigend sitzt meine Mitbewohnerin im Bett neben mir. Offenbar wieder einer der Momente, in denen sie mich ausblendet. Aber auch ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass wir am nächsten Tag mehr als 13.000 Kilometer würden wandern müssen.
„Oder sind das Meter? Es sind Meter! Aber wie kommt diese Wander-App dann auf 35 Kilometer?!“
„Weil der Wanderweg nicht immer direkt am See entlang führt.“
„Verstehe. Gut, das soll uns nicht stören. Wir wandern morgen die Strecke!“
35 Kilometer sind nicht wenig, aber eben auch nicht unmenschlich viel. Immerhin bin ich diese Distanz schon einmal gejoggt, da sollte sie gehend ja wohl kein Problem darstellen. Ich steige also in die konkrete Planung ein:
„Wir werden etwa acht Stunden brauchen, wenn ich mal großzügig pro Kilometer 15 Minuten Gehzeit berechne. Wir machen ja auch Pausen und so.“
Letztlich wurden es rund neun Stunden, da ich eines nicht eingeplant hatte: jene Tatsache, die mich während dieses Bergurlaubes jeden Tag aufs Neue überrascht hatte: dass die Wege in den Bergen auffallend häufig bergauf verlaufen.
„Das kann dich doch nicht ernsthaft überraschen?!“, fragte mich meine Mitbewohnerin auf allen Gipfeln, die wir in den zurückliegenden zwei Wochen erklommen hatten. Es wurde zur running Frage.
„Ein wenig schon. Ich meine, klar, es geht bergauf, wenn man einen Berg hochgeht. Aber das zieht sich ja wie ein roter Faden bis hoch zum Gipfel. Ich dachte, hier und da durchschreitet man mal ein Tal oder so.“
Auch die Umrundung des Forggensees war von erheblichen Steigungen gekennzeichnet, die ich so nicht vorhergesehen hatte, da ein See kein Berg ist, nicht einmal ein Bergsee. Doch der Marsch geriet noch aus anderen Gründen zu einer körperlichen Herausforderung.
Dazu muss der Leser wissen, dass dieser See nicht ganz „rund“ ist, sondern sich am nördlichen Ende etwas ausgefranst in die Landschaft presst. Das nördliche Ende zu umlaufen bedeutet permanente Umwege, weil man immer wieder vor weiteren Ausläufern des Sees steht, die ebenfalls umlaufen werden wollen.
Kilometer zehn: Ich blicke auf meine GPS-Uhr, die mir die geleisteten Kilometer anzeigt.
„Wir haben schon zehn und sind ja schon fast bei der Hälfte des Sees! Das wird ’ne einfache Nummer. Das sind keine 35 Kilometer! Um fünf Uhr sind wir wieder zuhause“, erkläre ich meiner Mitbewohnerin, die langsam ahnt, dass ich die Sache völlig naiv angehe und den Bezug zur Realität vollumfänglich verloren habe.
„Naja, das sieht zwar so aus, als seien wir schon an der nördlichen Spitze, aber da kommen noch Ausläufer, die wir umgehen müssen.“
„Ja, gut, aber die sind ja klein.“
Ich betrachte „Google Maps“, sehe die Ausläufer und schmunzele in mich hinein.
„Das sind wir doch zügig drumherum“, denke ich, „Was macht die sich so in die Hose? Wandern ist mein Ding irgendwie. Ich lasse mich doch von so einem albernen Stausee nicht bezwingen!“
Weitere zwei Kilometer später:
„Wo ist eigentlich dieser See?!“, frage ich meine Mitbewohnerin. Die Situation hat sich inzwischen zu meinen Ungunsten gedreht. Nach und nach realisiere ich, dass die ausgefranste Nordseit des Sees zum Problem wird. Die Ausläufer zwingen uns, weit ab vom eigentlichen Ufer zu wandern, da dort nicht immer entsprechende Wege vorhanden sind. Mehrere Kilometer laufen wir einer Landstraße entlang und sehen vom See: nichts.
„Der See ist etwa einen Kilometer östlich von uns“, klärt meine Mitbewohnerin mich auf.
„Nach meinen Berechnungen müssten wir schon zuhause sein!“
„Wir laufen gerade erst um den ersten Ausläufer!“
Wir erreichen eine Anhöhe. Und ich sehe nun jenen Ausläufer.
„Grundgütiger! Da müssen wir rum?!“
„Ja!“
„Der sieht auf der Karte viel kleiner aus!“
„Auf der Karte sieht alles viel kleiner aus!“
„Ja, aber doch nicht so viel kleiner!“
„Sie können wohl kaum 15 Quadratkilometer eins zu eins auf eine Karte drucken!“
„Das wäre aber besser gewesen. Damit kann doch niemand rechnen! Dieser Ausläufer ist ja so groß wie unser Aasee!“
„Größer sogar. Deshalb werden wir eben doch auf 35 Kilometer kommen!“
Ich schweige. Ich muss das erst einmal verarbeiten. Natürlich, 35 Kilometer sind zu schaffen. Ich wollte ja auch ganz bewusst viel wandern. Aber die Rahmenbedingungen sind mitunter ungünstig.
Kilometer 19:
„So, jetzt sind wir aber an der Nordspitze!“
„Nein, Seppo, da kommt erstmal wieder ein Ausläufer. Da ist keine Brücke, wir müssen also drumherum.“
Innerlich kollabiere ich. Nach einem Stimmungshoch falle ich wieder in ein Loch. Seit Kilometer 15 durchlebe ich die klassischen Phasen einer manischen Depression.
„Mitbewohnerin, meine manische Phase vorhin fand ich irgendwie besser.“
„Ich auch.“
Die Sonne brennt. Es geht wieder bergauf. Wir beschließen, eine Pause einzulegen. Finden eine Bank in einem niedlichen Dorf. Niedliche Dörfer sind solche, die man gerne durchschreitet, in denen man aber cainesvallz leben möchte, was man auch jedes Mal aufs Neue verbalisiert:
„Also das sieht ja schön hier aus. Aber leben möchte ich hier nicht.“
Ich öffne meinen Rucksack.
„Kaffee oder Tee?“, biete ich meiner Mitbewohnerin an.
„Beides.“
Ich trage in diesem Urlaub stets zwei Thermoskannen mit Kaffee und Tee bei mir, sie hingegen eine Wasserflasche mit Wasser und eine Wasserflasche mit Milch gefüllt. Für ihren Kaffee, den ich schwarz trinke. Sie zuckert ihren Kaffee auch. Den Zucker hat sie zuvor bei „Rewe“ in Füssen geklaut, bei diesen Kaffee-Automaten, die inzwischen in fast jedem Supermarkt stehen. Sie wollte einfach keinen Zucker kaufen.
Sie nimmt einen Schluck Tee und röchelt plötzlich schwer.
„Was ist denn das?!“
„Das ist der Ingwer-Tee! Ich habe noch etwas echten Ingwer dazugegeben. Lass mal probieren.“
Und ja, der Tee ist unmenschlich scharf geraten!
„Warum tust du in einen Ingwer-Tee noch Ingwer?!“
„Weil mir niemand erzählen kann, dass in Ingwer-Tee Ingwer ist. Das sind doch bloß künstliche Aromen. Da hab ich gedacht, ich verfeinere ihn noch mit einer Ingwer-Knolle.“
„Ab morgen koche ich unsere Tees!“
„Ei?“, frage ich sie.
„Nein, ich nehme ’ne Banane.“
Ich pelle mir vier Eier und weiß danach nicht, wohin mit der Schale.
„Eierschale ist doch praktisch Kompost, oder?“
„Ich glaube.“
„Kann ich hier einfach liegenlassen, oder? Wenn ich sie zu einem kleinen Häufchen zusammenschiebe?“
„Joa.“
„Also ich pack die jetzt nicht in meinen Rucksack.“
„Du musst sie ja nicht unbedingt auf der Bank liegenlassen.“
„Ne, muss ich nicht. Aber ich könnte. Ich zahle schließlich Kurtaxe. Da wird ja wohl das Verschmutzen von Bänken eingepreist sein.“
Wir gehen weiter. Vom See nichts mehr zu sehen. Das muss aber so. Denn wir laufen den offiziellen Radweg, der um den See führt. Einen Wanderweg gibt es nicht. Dann endlich finden wir einen kleinen Fußweg, der uns nach Stunden endlich wieder unmittelbar an das Ufer führt. Es macht wieder Spaß, ich rutsche erneut in eine manische Stimmungsphase. Wir wandern entlang einem Abhang. Der Weg ist anspruchsvoll, aber abwechslungsreich. Zu unserem Erstaunen treffen wir auf ein älteres Ehepaar (die Ehe unterstelle ich einfach mal), das mit Fahrrädern unterwegs ist. Der Weg ist alles andere als geeignet für Räder:
An einer steilen Treppe bieten wir unsere Hilfe an, die der Mann jedoch ablehnt. Er will die Räder alleine hinuntertragen. Ich kann ihn verstehen. Und er weiß natürlich selbst, dass es falscher Stolz ist. Seine Frau auch. Sie schweigt. Ohnehin scheint sie nicht damit einverstanden zu sein, dass sie diesen Weg genommen haben. War vermutlich sein Vorschlag. Nach der Treppe sehen wir die beiden nicht wieder. Vielleicht haben sie aufgegeben. Sind umgekehrt. Oder sie hat ihn ermordet.
„Oder sie sind abgestürzt und liegen jetzt im See!“, spekuliert meine Mitbewohnerin.
„Immerhin haben sie ihn dann mal gesehen!“
Denn wieder entfernen wir uns vom Ufer. Und jetzt erst haben wir den letzten Ausläufer umlaufen. Es geht endlich an den Rückweg! Ich werde wieder euphorisch.
„19 Uhr sind wir zuhause! Und es werden keine 35 Kilometer! Vielleicht 25.“
„Wir müssen noch um den anderen See dahinten“, beiläufig meine Mitbewohnerin.
„Anderen See?! Wir müssen noch um einen anderen See?!“
Sie zeigt mir den Illasberg See auf Google Maps. „Da müssen wir auch rum, weil es keinen Weg zwischen den beiden Seen gibt.“
Ich kollabiere innerlich. Depressive Phase.
„Warum wurde ich nicht vorher darüber informiert?!“
„Ich hatte dir das auf der Karte gezeigt!“
„Ja, aber ich hielt es für einen kleinen Tümpel! Das ist ja ein ganzer See! Man hätte mich da deutlicher informieren müssen! Der sah auf der Karte wesentlich kleiner aus!“
„Man kann ja ranzoomen!“, frotzelt meine Mitbewohnerin.
„Ich breche zusammen.“
Was ich während des Zusammenbruches noch nicht weiß: Auch um den Illasberg See gelangt man nicht auf direktem Wege, sondern nur über Umwege. Aber immerhin befinden wir uns schon auf der Ostseite des Sees, den wir eigentlich umrunden, des Forggensees, der neben dem Tegelberg liegt.
„Wir kommen gerade dem Tegelberg gefährlich nahe. Es würde mich nicht wundern, wenn wir den auch noch umrunden müssen. Müssen wir vielleicht noch über die österreichische Grenze, um den Forggensee zu umrunden?! Führt uns dieser Weg gar durch den Vatikan?! Man wird uns für Flüchtlinge halten. Wir können froh sein, dass die AfD noch keine schießenden Grenzsoldaten durchgesetzt hat. Scheiß Nazis.“
Derweil geht die Sonne unter. Wir spüren inzwischen unsere Beine. Unsere Fotografie-Frequenz hat enorm abgenommen, viele gute Motive werden nicht mehr abgelichtet, da wir zu müde geworden sind. Fotografieren hält nur auf.
„Ich esse noch ’ne Wurst.“
Wir machen in diesem Wanderurlaub nie lange Pausen. Immer nur so zehn Minuten. Schluck Kaffee, ein Ei oder so, mal ’ne Wurst. Keine Kohlenhydrate gilt auch im Urlaub und das Wurstangebot im Allgäu kann sich sehen lassen. Meine Mitbewohnerin widert mein Wurstkonsum inzwischen an.
„Du kannst Unmengen an Wurst essen und nimmst nicht zu!“, versuche ich sie zu überzeugen. Doch ihre Stimmung ist inzwischen gekippt. Meine aber auch. Ich bin plötzlich gelassen und gut gelaunt, sie hingegen ist schlicht müde. Und genervt. Weil wir auch an der Ostseite des Sees den See nicht sehen. Doch dieses Mal ist es unser Fehler, da wir den entsprechenden Wanderweg nicht finden. Nach 29 Kilometern gehen wir allerdings auch kein Risiko mehr ein, denn manch Weg hat sich schon als kilometerlange Sackgasse entpuppt. Darum bleiben wir auf der sicheren Seite und folgen dem Radweg, von dem wir wissen, dass er wieder nach Füssen, unserem Ferienort, führt. Und auch mir ist inzwischen klar, dass wir auf 35 Kilometer kommen werden.
Der Akku meiner GPS-Uhr geht zuneige. Das ärgert mich nun am meisten, denn am Ende wird ein Teil unserer Wanderung auf der generierten Karte fehlen. Das Handy übernimmt nun das tracken der Wanderung und manch Leser wird sich fragen, warum ich nicht von Beginn an auf das Handy gesetzt habe. Das liegt einfach daran, dass meine Laufuhr mehr kann als jede tracking app und ich bezweifle, dass der Handyakku länger gehalten hätte.
Als wir auf einer Bank, unser Ziel endlich in Sichtweite, eine letzte Pause in der Abenddämmerung einlegen, hören wir ein seltsames Zischen.
„Was ist das?! Hörst du das?“, fragt meine Mitbewohnerin.
„Vermutlich eine Kuh.“
„Nein, guck! Das ist ein Eichhörnchen!“
Und tatsächlich, vor uns steht ein niedliches Hörnchen, das jedoch schwer am Sicken ist, wie man so sagt.
„Da ist aber jemand hochgradig auf Krawall gebürstet!“, erkenne ich als alter Zoologe, „Wenn die Angst haben, werden sie sehr aggressiv und müssen abgeschossen werden.“
Das Eichhörnchen scheint das zu verstehen und kommt noch lauter zischend weiter auf uns zu.
„Na toll, in Berlin greifen mich Wildschweine an und hier im Urlaub sind es Eichhörnchen.“
Es kommt noch näher. Wir müssen befürchten, dass es uns attackiert, was für die Tierchen nicht ungewöhnlich ist.
„Die Lage spitzt sich zu. Also wie albern sind denn nun diese Ereignisse?! Wenn es uns verletzt, können wir das ja keinem zuhause erzählen!“
„Sei ein Mann und beschütze mich.“
Ich nehme meine letzte Wurst aus dem Rucksack und werfe sie nach dem Raubtier. Und das erste Mal in meinem Leben treffe ich etwas! Das Eichhörnchen wird vom Wiener zur Seite geschleudert, berappelt sich und schlägt sich den Staub von seinen Schultern. Starrt uns kurz an, zischt noch einmal und verschwindet.
„Meine Wurst! Dafür habe ich eine Wurst geopfert!“
„Diese Nummer bleibt unter uns! Da bloggst du nicht drüber!“
„Tue ich nicht. Versprochen.“
Wir machen uns wieder auf. Noch etwa 50 Minuten brauchen wir für die letzten Kilometer. Nach der großen Hitze am Nachmittag frieren wir inzwischen. Zuhause angekommen sind wir zweierlei: müde und stolz.
Und seltsamerweise stelle ich fest, dass ich 35 gejoggte Kilometer leichter als gegangene empfinde.
Am Tag darauf schaffen wir nur noch vier Kilometer und brechen wegen Müdigkeit eine Städtetour ab. Doch am darauffolgenden Tag: setzen wir noch einen drauf. Dazu später einmal mehr.
Viele Fotos zu diesem Urlaub, penetrant viele Fotos!, finden Sie auf meiner Facebook-Seite!













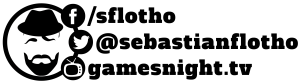

stramme Leistung, da gibts nichts zu meckern…
LikeGefällt 1 Person
Danke für ausführliches und interessantes Reiseerlebnis. Ich kenne die Gegend und jetzt wieder ganz neu. Muss wieder hin.
LikeGefällt 1 Person
Ich frage mich seit fünf Minuten, ob Wanderungen in Bayern eine Obergrenze haben sollten… Nur Horst und Seppo kennen die Antwort.
LikeGefällt 7 Personen
Hallo Seppo, von kampfesmutigen Eichhörnchen hab ich ja noch nie gehört. Hattest Du vor lauter Erschöpfung Halluzinationen oder hast Du an irgendwelchen Pilzen genascht?
LikeGefällt 4 Personen
ich erinnere an das eichhörnchen, das von einem polizisten erschossen wurde. bekommen sie angst, werden sie sehr aggressiv. die hörnchen, nicht die polizisten (nicht alle).
LikeGefällt 1 Person
Na, da konnte der Polizist wohl gut schießen, oder hat er da kleine Tierchen etwa aus Versehen getroffen, als er einen Bösen jagte?
LikeGefällt 1 Person
ich will hoffen, dass polizisten treffsicher sind. die eichhörnchengeschichte ist nicht ausgedacht. es kommt häufiger vor, dass sie geschossen werden, da man sie mitunter für tollwütig hält, was den abschuss wohl notwendig macht. es lohnt der blick wie sooft über den tellerrand hinaus,
LikeLike
Ach, deshalb gibt es auf unserem Grundstück keine Eichhörnchen.
LikeLike
Hallo Seppo.
Auf den Bildern siehst du aber recht entspannt aus. Wie kann man eigentlich im weißen Hemd wandern? Passt ja so gar nicht, vor allem nicht zu hässlichen Wanderschuhen.
LikeGefällt 4 Personen
die hemden-frage kommt nicht zum ersten mal. ich wanderte auch in einem roten hemd.
LikeLike
Das ist dann eine komische Angewohnheit. Sieht dann eher wie ein gemütlicher Spaziergang aus als wie eine Wanderung.
LikeGefällt 1 Person
ich bin meister der tarnung!
LikeLike
So kann man es auch sehen. Aber meist sieht man es ja im Gesicht wie fertig man ist nach so einer Strecke.
LikeGefällt 1 Person
da verweise ich auf das letzte „selfie“.
LikeLike
Da schaust du eher amüsiert.
LikeGefällt 1 Person
35 km – is ja nich ma Marathon!
LikeGefällt 1 Person
na eben!
LikeLike
made my day, sehr gelacht! Erinnert mich an meine mehrtägige Wanderung durch Irland mit John Willie, einem (vierbeinigen) Esel. Allerdings im strömenden Regen.
LikeGefällt 1 Person
wer ist in meinem bericht der esel? ;)
LikeGefällt 1 Person
im Zweifel das gefährliche Eichhörnchen 😉
LikeGefällt 1 Person
Zu dieser Jahreszeit ist die Lech schon recht kalt, stellt aber selbst für Eichhörnchen kein allzugroßes Hindernis dar, heißt es in einem örtlichen Reiseführer.
LikeGefällt 1 Person
Super, da seit ihr ja stramm gelaufen. Das du das ohne Kohlehydrate ausgehalten hast, ich wäre ausgetickt und hätte schlechte Laune. Ohne Kohlehydrate geht bei mir gar nichts mehr. Google maps hat keine Höhenlienien, da kannst du ganz schön reinfallen, ist mir auch schon passiert. Was machst du wenn alle Akkus von Handy, Tracker und Smarphone leer sind? Lese gern solche Berichte und wäre dann auch gern dort. Viele Gr0ße
LikeGefällt 1 Person
ich wäre auch gerne wieder da!
LikeGefällt 1 Person
Respekt! Nach meiner diesjährigen Wanderung auf die Zugspitze kann ich dein Empfinden gut nachvollziehen. Das sind zwar „nur“ 24 km, davon aber etliche stramm bergauf.
LikeGefällt 1 Person
ebenfalls respekt! wir standen zumindest am fuße der zugspitze. uns hatte allerdings schon der tegelberg gereicht. stramm bergauf ist natürlich eine ganz andere nummer, als um einen see zu laufen.
LikeGefällt 1 Person
Danke. Ich bin froh, es geschafft zu haben, aber normale Bergwanderungen reichen mir sonst auch.
LikeGefällt 1 Person
Wandern gerne, aber nur auf ebener Strecke. In den Bergen geht das gar nicht, da fehlt mir jeglicher Ehrgeiz (und die Pumpe hat da auch keinen Spaß dran).
Du kannst stolz auf Dich/Euch sein! Ich hätte die verbliebene Akku Laufzeit für einen Anruf beim örtlichen Taxi Unternehmen genutzt. ;-)
LikeGefällt 2 Personen
Ja, nun – vielleicht wäre der Bannwaldsee oder der Hopfensee (die links und rechts von dem riesigen See auf der Karte liegen) einfacher zu umwandern gewesen? Respekt, dass ihr so lange durchgehalten habt.
LikeGefällt 1 Person
Der hopfensee wurde eine Woche später umjoggt. Der ist allerdings wirklich etwas umfangarm.
LikeLike
Der einzige Alpensee, den ich umwandert habe, ist der Spitzingsee, aber der ist nun wirklich sehr klein (aber fein).
LG
Ulrike
LikeGefällt 1 Person
Respekt! Seppo entpuppt sich als Dialektiker reinsten Wassers… Zunächst in dem Spießer, der in seiner absoluten Negation sich selbst als Positives setzt, sodann in dem Weg, der nicht als einfacher (=kurzer), sondern als mit sich selbst entzweiter (=mäandernder) in der absoluten Zerissenheit (=rechts oder links?) sich selbst findet (da isser, weiter als gedacht)…
Hegel wäre stolz!
LikeGefällt 2 Personen
Nur hinan, hinan zu den Höhen! Damit ihr müden Flachländer mal erfühlt, was gute, würzige Luft zu atmen bedeutet. :o) Der nächste Schritt wäre von den Voralpen in die „echten“ Alpen, dazu braucht ihr nur ein bissl weiter gen Süden reisen, in die Alpenrepublik… :-)
LikeGefällt 1 Person
jaja.. Höhenmeter, „falscher“ Ingwertee und dem zur Neige gehenden Akkuzstand-das sind Wandergeschichten die das Leben schreibt.. :-) Apropos– sehr fein geschrieben!
LikeGefällt 1 Person
Ich hab ja kürzlich die Bergischen 50 gefinished und beim Megamarsch 65 km gemacht und in meiner Übungsphase vorher von vielen Läufern gehört, dass ein Halb- oder Marathon sie weniger anstrengt, als diese Streckenwanderungen.
Daher: Respekt für die 35 km an Euch!
LikeGefällt 1 Person
Also ich bin schon hunderte mal um den See geradelt, aber dass ich rumlaufe … wow, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Wenigstens hast Du den schönen Trailteil gefunden. :)
LikeGefällt 1 Person
Hab noch nie so schöne „schwarze-Balken“ auf Fotos gesehen :-) Das mit der See-Umrundung mache ich vielleicht auch mal, dann aber auf 10 Tage verteilt, mit Wellnesshotel und vielen Pausen, hehe :-)
LikeGefällt 1 Person
Hallo Seppo, bin zum ersten Mal auf deine Seite aufmerksam geworden. Ich finde die Art und Weise wie du diesen Text verfasst hast sehr unterhaltsam. Im Grunde erzählst du nur wie du den See umwandert bist, aber du verpackst die Geschichte mit so viel Leben, dass man gerne bis zum Schluss lesen möchte. Ich fand die Stelle mit den Eierschalen lustig (und ich glaube auch, dass es nicht ganz so schlimm wäre wenn man die Schalen irgendwo im Freien aussetzt ;) ).
Vielen Dank auch, dass du meine Einleitung geliked hast (bin neu am Start bei WordPress).
Gruß,
Dany
LikeGefällt 2 Personen
Respekt. Ich bin mal um den Forggensee gefahren. Auf einem Leihfahrrad mit kaputter Gangschaltung. ;-)
LikeGefällt 1 Person
Eichhörnchen, die sich an Menschen heranmachen, sind in der Regel krank und hilfsbedürftig, nicht tollwütig. Aus purer Verzweiflung suchen vor allem junge, hungrige Hörnchen, die ihre Mutter verloren haben, die Nähe des Menschen und klammern sich schon mal am Hosenbein fest. Würstchenwerfen ist da vielleicht eher nicht hilfreich… bezweifle, dass die das mögen! ;-)
LikeGefällt 1 Person
es aß die wurst und starb elendig.
LikeLike